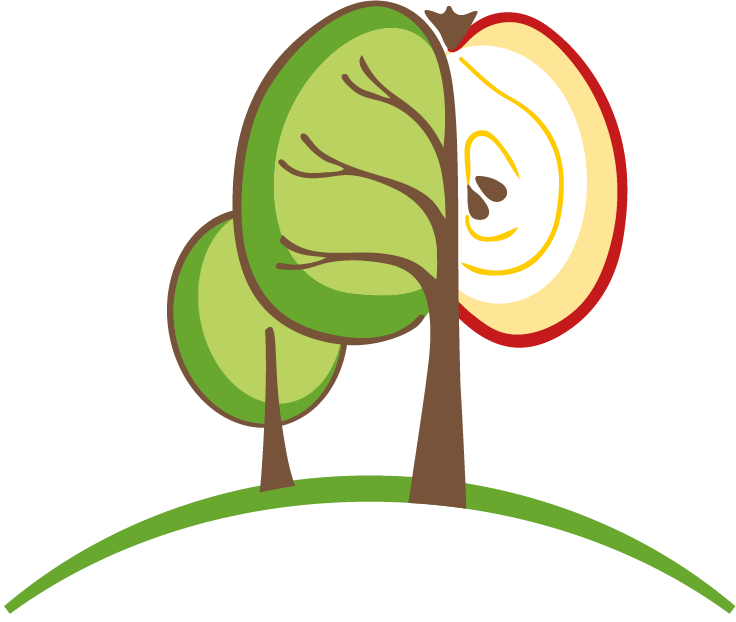Der Baumschnitt im Streuobstgarten
Grundsätzlich ist es zu empfehlen, die eigenen Obstbäume auch selbst zu schneiden. Zumindest aber, sollten die Bäume über mehrere Jahre hinweg von ein und derselben Person geschnitten werden. So ist gewährleistet, dass die gewünschte Kronenform erhalten oder neu erzogen wird. Um die Scheu vor dem Schnitt zu nehmen, wird der Besuch eines Kurses unbedingt empfohlen, um den naturgemäßen Schnitt an Hochstammobstbäumen zu erlernen.
Wer sich selbst den Schnitt nicht zutraut, sei an die vielen ausgebildeten Obstbaumpfleger:innen und Obstbaumwart:innen verwiesen.
Ziele des Obstbaumschnittes im Streuobstbau
Es liegt auf der Hand, dass regelmäßige Erträge in guter Fruchtqualität angestrebt werden. Dafür benötigt der Baum allerdings optimale Lichtverhältnisse in der Krone, um ausreichend Photosynthese betreiben zu können und so die Früchte und sich selbst optimal zu versorgen. Zu dichte Kronen, zu wenig Blattmasse oder zu viele Früchte, die versorgt werden müssen, rufen beim Baum unterschiedliche Reaktionen hervor. Die Aufgabe der Baumbesitzer:innen besteht darin, diese Zeichen richtig zu deuten und den Baum in seinem Streben zu unterstützen. Letztendlich geht es aber immer darum, möglichst wenig Schnittaufwand zu haben.
Aus der Sicht des Menschen, weil das ein Kosten und Zeitfaktor ist. Aus der Sicht des Baumes vor allem deshalb, weil der Schnitt den Baum verletzt und von außen beeinflusst – beides Umstände, die sein angestrebtes Gleichgewicht zwischen Wachsen und Früchtebringen ins Wanken bringen können.
Richtiger, naturgemäßer Obstbaumschnitt ist keine Geheimwissenschaft, sondern folgt den Regeln des Wachstums des Baumes. Um diese zu lernen, muss man sich mit der Thematik auseinandersetzen, viel üben, beobachten und auch Rückschläge einstecken können.
Drei häufige Missverständnisse zum Baumschnitt
Missverständnis 1: „Ich schneide, damit der Baum niedrig bleibt.“
Richtig ist: Mit Hilfe von Säge und Schere kann man das Höhenwachstum eines Obstbaumes nur brachial und für Baum und Besitzer:in unbefriedigend einbremsen. Die Höhe eines ausgewachsenen Obstbaumes wird durch seine Genetik festgelegt. Wurde er auf eine starkwachsende Unterlage veredelt, wird er auch danach trachten, diese biologisch festgelegte Höhe zu erreichen. Solange er in der Lage dazu ist, wird er wachsen und erst dann damit aufhören, wenn er „erwachsen“ ist. Dann erst stellt sich das sogenannte „physiologische Gleichgewicht“ ein, bei dem sich Fruchten und Wachsen die Waage hält und der Obstbaum kaum mehr höher wird. Die meisten Obstbäume (von Walnuss, Mostbirne und Kirsche abgesehen) werden um die sechs bis zehn Meter hoch. Soll der Baum kleiner bleiben, müssen die Sorten auf schwachwachsende Unterlagen veredelt werden.
Missverständnis 2: „Alle Wassertriebe müssen jedes Jahr weggeschnitten werden.“
Richtig ist: Unter „Wassertrieben“ verstehen wir jene einjährigen Triebe, die meist wie Weidenruten aufrecht in den Baum hineinwachsen. Dass es sie überhaupt gibt, ist meist ein Ergebnis von zu starkem und falschem Schnitt. Dennoch sind manche Triebe davon sinnvoll nutzbar. Im zweiten Jahr setzen nämlich genau diese Triebe Blütenknospen an und bringen die besten Früchte, weil Holz und Blätter, die die Früchte versorgen, noch jung und vital sind.
Missverständnis 3: „Der Baum muss so geschnitten werden, dass ein Hut durchgeworfen werden kann.“
Richtig ist: Je stärker ein Obstbaum im Winter geschnitten wird, umso stärker treibt der Baum im folgenden Frühjahr aus. Das hat damit zu tun, dass der Baum eine an die Größe der ursprünglichen Krone angepasste Wurzel hat. Diese bleibt beim Schnitt erhalten und kann den Knospen, die den Schnitt „überlebt haben“ nun die Wachstumsenergie übertragen, die sonst für viel mehr Knospen vorgesehen gewesen wäre. Es gilt also folgende Regel: Starker Schnitt = starkes Wachstum, wenig Schnitt = schwaches Wachstum im Folgejahr.
Der richtige Schnittzeitpunkt
Womit wir beim Schnittzeitpunkt wären: Den „richtigen Schnittzeitpunkt“ gibt es nämlich nicht!
Wer Wachstum fördern will, wird im Winter schneiden (siehe Missverständnis 3). Will jemand das Wachstum ein wenig bremsen, ist ein Schnitt im Sommer (hier sind die Zeitpunkte obstartabhängig) sinnvoll. Besonders ist der Schnitt der Walnuss: Diese sollte ausschließlich in der Vegetationszeit geschnitten werden, um ein „Ausbluten“ des Baumes zu verhindern. Am besten eignet sich dazu der August oder alternativ gleich kurz nach dem Austrieb Ende Mai oder Juni. Dadurch hat der Baum die volle Vegetationszeit die Möglichkeit, die Schnittwunden wieder zu verheilen.
Blatt- und Blütenknospen
Eine kurze Anmerkung noch zu den Knospen der Obstbäume: Man unterscheidet prinzipiell zwischen Blatt- und Blütenknospen. Sind diese einmal vom Baum angelegt, können sie sich nur in Ausnahmefällen wieder umwandeln. Wer also alle Blütenknospen wegschneidet, darf sich nicht wundern, wenn der Baum nichts trägt. Blütenknospen bilden sich vorzugsweise auf relativ flach stehenden Ästen. Das ist auch der Grund, warum die Äste früher „herunterformiert“ wurden. Dieses Herunterbinden hatte den Zweck, dass der Baum schneller Früchte trägt und dadurch weniger stark wächst.
Der Pflanzschnitt
Nach der Pflanzung sollte der Baum an seinen endgültigen Standort angepasst geschnitten werden. Damit können die verbliebenen Knospen von dem durch die Pflanzung verringerten Wurzelkörper gut versorgt werden. Dazu ist folgende Vorgangsweise zu wählen:
1. Drei bis vier günstig stehende Triebe auswählen und als zukünftige Leitäste belassen. Diese sollen räumlich gut verteilt rund um den Stamm stehen. Die oberste Knospe jedes Astes soll in der gleichen Höhe stehen („Saftwaage“). Beim Schnitt soll darauf geachtet werden, dass die oberste Knospe nach außen „schaut“, damit die Krone des Baumes ausladend werden kann.
2. Die Stammverlängerung (Mitteltrieb) soll bei der Erziehung von Hochstammobstbäumen unbedingt stehen gelassen werden. In der Länge ist sie auf ungefähr zehn Zentimeter länger als die oberste Knospe der Seitentriebe einzukürzen.
3. Schlitzäste, das sind zu steil ansetzende Triebe, werden konsequent entfernt. Sie drohen sonst unter der Fruchtlast im höheren Baumalter auszubrechen, da sie nicht gut mit der Stammverlängerung verwachsen sind.
4. Geduld: Auch wenn beim Pflanzschnitt z.B. erst zwei Leitäste übrig bleiben (weil andere Schlitzäste waren), ist das in Ordnung. Die anderen Leitäste entwickeln sich aus der Stammverlängerung über die nächsten Jahre. Damit erreicht man automatisch auch eine gewünschte Streuung der Leitäste in der Höhe.
5. Im Jahr der Pflanzung ist neben dem Freihalten der Baumscheibe und dem Wässern in Trockenperioden auch darauf zu achten, dass im Juni Stamm und Stockaustriebe entfernt werden. Um dem Baum nicht zusätzlich Kraft zu kosten, sollten zumindest im ersten Standjahr eventuell vorhandene Blütenknospen ausgebrochen werden. Die Versorgung von Früchten würde den jungen Baum beim Anwachsen an seinem neuen Standort behindern.
Saftwaage: Unter einer Saftwaage versteht man im Obstbaumschnitt, dass alle obersten Knospen der Leitäste in der gleichen Höhe liegen. Dadurch werden diese Knospen alle gleich gut versorgt und wachsen gleichmäßig stark.
Die Jugenderziehung – der Weg zum stabilen Kronengerüst
Die ersten Jahre nach der Pflanzung sind entscheidend für das restliche Baumleben. Der richtige Schnitt und eine umsichtige Pflege sind eine Garantie dafür, dass der Obstbaum die folgenden Jahrzehnte mit den vielfältigen Herausforderungen durch Klima und menschliches Handeln zurechtkommen kann.
Je nach Obstart und der Wüchsigkeit der Sorte werden die ersten sechs bis zehn Jahre daher dem Aufbau der Baumkrone gewidmet. Dabei ist auf folgende Punkte zu achten:
Auch wenn das Ziel die Erziehung von Hochstammkronen ist, sollte zu Beginn die erste Astpartie nicht unbedingt gleich in 1,8 m Höhe ansetzen, da der Stamm noch nicht kräftig genug ist, den „Oberbau“ sicher zu tragen. Sehr leicht kann sich dann der ganze Baum umbiegen, sogar abbrechen oder nicht mehr standfest sein. Der Kronenansatz bleibt in der Höhe zeitlebens und wächst nicht nach oben mit. Daher sollte die Höhe des Kronenansatzes gut überlegt werden. Er sollte maximal im zweiten Drittel der Höhe des Baumes ansetzen. Je dünner der Stamm, umso niedriger der Kronenansatz. Die Leitäste können später durch den Schnitt immer noch hinaufgesetzt werden. Wichtig ist auch, dass ein ausreichendes Dickenwachstum des Stammes erfolgt. Dies geht nur, wenn der Baum genug Blätter hat, die die Versorgung der Pflanze gewährleisten.
Drei bis höchstens vier Leitäste, die gut verteilt rund um den Baumstamm angeordnet sind, bilden das tragfähige Gerüst des Baumes. Sie sind es, die in den nächsten Jahrzehnten die Last der Blätter und Früchte tragen müssen. Daher ist ein Winkel zum Stamm um die 60 Grad ideal. Die obersten Enden der Äste sollen ungefähr gleichhoch stehen (Saftwaage), ihr Ursprung am Stamm sollte jedoch in der Höhe jeweils um 30 bis 50 cm versetzt sein, damit dieser nicht durch die hohe Belastung an einer Stelle auseinanderbricht.
Wie schon beim Pflanzschnitt erwähnt, bildet sich eine naturgemäße Baumkrone um eine Mittelachse, die sogenannte Stammverlängerung. Sie trägt die obersten Knospen und bildet so einerseits den Mittelpunkt des Baumes und bremst andererseits die Leitäste im Wachstum.
Die gesamte Krone sollte weder zu tief noch zu hoch angesetzt werden. Sind die ersten Äste zu tief, wird man sehr bald mit der Pflege der Baumscheibe nicht mehr zurechtkommen. Zudem sind tiefe Äste sowohl bei der Beweidung als auch bei der Mahd unpraktisch. Eine zu hoch angesetzte Krone erschwert andererseits sowohl Ernte als auch Pflege und gefährdet zudem die Stabilität des Baumes. Ähnlich wie bei Waldbäumen muss auch der Obstbaum erst einen ausreichenden Stammdurchmesser erreichen, um stabil zu stehen. Bei zu „dünnem“ Gerüstaufbau brechen leicht die Spitzen des Baumes oder er wird durch den Wind „ausgehebelt“. Ein Kronenansatz zwischen der Hälfte und dem oberen Drittel der Stammhöhe ist daher ideal. Im Zweifel kann man später zu tiefe Äste durch höherstehende ersetzen. Aber Achtung! Leitäste, die einmal weggeschnitten wurden, lassen sich nicht einfach so wieder ersetzen.
Beim jährlichen Erziehungsschnitt wird also darauf geachtet, dass die Leitäste und die Stammverlängerung harmonisch sowohl in der Länge als auch im Durchmesser wachsen. Ist der Zuwachs zu gering (weniger als 20 cm pro Jahr), sollte die Ursache gesucht werden. Eventuell ist die Nährstoffversorgung oder das Wasserangebot zu gering. Oder der Baum hat keine ausreichende Stütze und kann sich nicht gut bewurzeln. Häufig haben schlecht wachsende Bäume auch Probleme mit Wühlmäusen oder sind einfach auf einer schwachwachsenden Unterlage veredelt. Ein „zu starkes Wachstum“ gibt es übrigens in dieser Lebensphase des Obstbaumes nicht. Sobald die physiologische Endgröße erreicht ist, beginnt der Baum von selbst Blütenknospen anzusetzen. Mit dem Beginn des Ertrages tritt auch die nächste Phase des Schnittes ein – der Erhaltungsschnitt.
Checkliste: Jugenderziehung
- Erziehungsschnitt zwischen 2. bis ca. 8. Standjahr (je nach Sorte und Obstart auch länger)
- Nach innen wachsende Partien entfernen und auf außen zeigende Augen schneiden
- Bevor der Vollertrag einsetzt, muss sich zuerst ein stabiles Kronengerüst entwickeln
Kronenformen im Streuobstbau
Die wichtigsten Kronenformen sind Pyramiden-, Hohl- und Öschbergkronen.
Pyramidenkrone: Die Krone hat ungefähr die Form einer Pyramide. Die Stammverlängerung in der Mitte bildet den höchsten Punkt der Krone. Die Leitäste sind gleichmäßig um den Stamm verteilt und bilden die Seiten der Pyramide.
Diese „Christbaumform“ ist je nach Obstart und Obstsorte dennoch immer unterschiedlich. Z. B. bildet die Sorte „Schöner von Boskoop“ sehr breite und beinahe kugelige Kronen, während „Kronprinz Rudolf“ eine schmale, sehr hohe Krone ausbildet. Schneidet man bei diesen Kronen den Mittelteil (die Stammverlängerung) heraus, um das Höhenwachstum zu begrenzen, erreicht man fast immer das Gegenteil. Die Leitäste richten sich auf und statt einer zentralen Mitte bilden sich drei oder vier gleich stark wachsende, steil aufrechtstehende „Bäume im Baum“.
Hohlkrone: Diese, häufig bei Pfirsich, Apfel und Marille anzutreffende Kronenform, verzichtet in der Erziehung des Jungbaumes auf eine zentrale Mitte und setzt stattdessen auf meist vier gut im Raum verteilte Leitäste. Die Überlegung dahinter ist, dass sich die „Wuchsfreudigkeit“ des Baumes auf die vier Leitäste gleichmäßig verteilt, was das Wachstum etwas bremst und die Belichtung der Krone erleichtert. Hohlkronen verlangen in der Erziehung eine fachkundige Hand und in der Erhaltung einen kundigen, nicht zu radikalen Schnitt, weil hier die Gefahr der „Wasserreiserbildung“ besonders hoch ist. Eine Hohlkrone kann keinesfalls aus einer ehemaligen Pyramidenkrone gebildet werden, indem man einfach die zentrale Mitte herausschneidet. Übermäßige Wassertriebe und ungleichmäßiges Wachstum sind die Folgen solch radikaler Schnittmaßnahmen.
Oeschbergkrone: Diese aus Deutschland übernommene Kronenerziehungsform wird aus einer recht schmalen Stammverlängerung (Spindel) und flach ansetzende, dann aber steil nach oben strebenden Leitästen gebildet (weinglasförmig). Die Oeschbergkrone wurde mit dem Ziel, hohe Fruchtqualitäten (Tafelobst) von großkronigen Obstbäumen zu ernten, entwickelt. Sie zeichnet sich durch lediglich eine Leitast-Etage aus. Vorteil hierbei sind niedrigere, aber sehr stabile und tragfreudige Bäume mit der Hauptertragszone im unteren Kronenbereich. Nachteil ist, dass die Erziehung dieser Kronenform einiges an Fachwissen voraussetzt.
Der Erhaltungsschnitt
Ab dem 10. bis 15. Standjahr beginnen die Obstbäume regelmäßig zu tragen.
Sie befinden sich dann meist in einem Gleichgewicht von Wachsen und Fruchten. Für die Bewirtschafter:innen beginnt nun die Zeit des regelmäßigen reichen Fruchtgenusses und der Ernte. Alle drei bis fünf Jahre sollte auch in dieser Phase der Obstbaum gepflegt werden. Das Wichtigste ist dabei, die Belichtung und Durchlüftung des Baumes zu erhalten. Zu dicht stehendes, abgebrochenes oder durch Hagel oder Sturm beschädigtes Holz soll entfernt werden. Dabei ist auf die richtige Schnittführung zu achten.
Bei zahlreichen Obstarten (vor allem Apfel, Birne und Zwetschke) kommt es zudem zu einem Rhythmus, in dem es Trag und Rastjahre gibt. Diese „Alternanz“ kann mit Hilfe des richtigen Schnittes beeinflusst werden. So kann in den „Tragjahren“, während des Winterschnitts, schon lange bevor die Blüte beginnt, der eine oder andere blütenbeladene Fruchtast bewusst herausgeschnitten und so die Zahl der zukünftigen Früchte verringert werden. Der Obstbaum dankt diese vorausschauende Schnittführung nicht nur mit regelmäßigeren Ernten, auch die Fruchtqualität steigt und die Bäume bleiben länger fruchtbar. Um Früchte in entsprechender Qualität ernten zu können, ist darauf zu achten, dass die Fruchttriebe kräftig und gut versorgt sind. Altes „Quirlholz“ sollte daher gegen junges kräftiges Fruchtholz ausgetauscht werden.