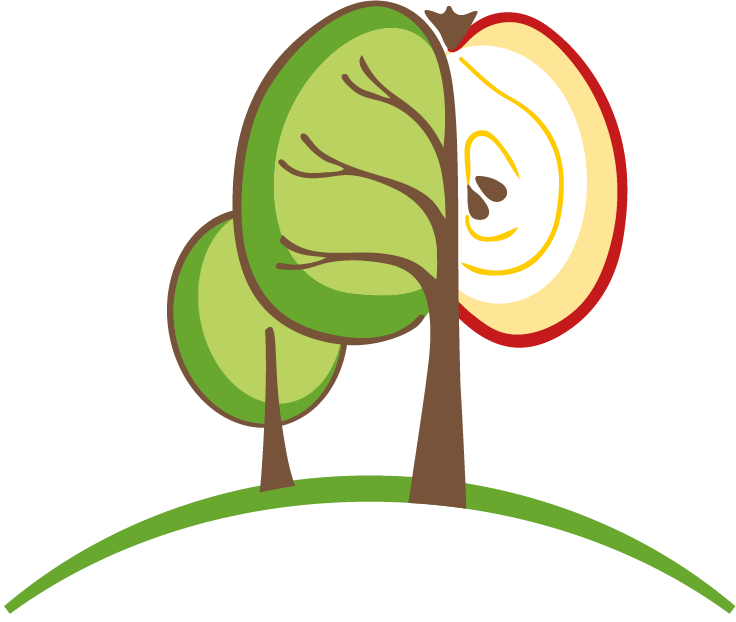Allgemeine Beschreibung
Der Weiße Rosmarin (Synonyme: "Weißer Rosmarinapfel", "Weißer Italienischer Rosmarinapfel", "Rosmarina Bianca") war bereits Anfang des 19. Jhdt. in Südtirol ein sehr geschätzter Marktapfel und wurde später von dort aus in der österr.-ung. Monarchie verbreitet. Der Weiße Rosmarin ist eine sehr empfehlenswerte Winterapfelsorte. Die Bäume bevorzugen nährstoffreiche Böden und warme Lagen. Die gelblichweißen Früchte mit ihrer markanten Deckfarbe und rosmarinartigen Würze, sind sowohl für den Frischverzehr, als auch für die Küche bestens geeignet. Auf Grund der höheren klimatischen Ansprüche, beschränkte sich die Auspflanzung der Sorte vorzugsweise auf die so genannten Gunstlagen für den Obstbau. Deshalb ist diese Sorte in Österreich eher selten anzutreffen. Zu Unrecht, möchte man meinen, weil wir auf Grund der Klimaveränderungen der letzten Jahre mittlerweile über die erforderlichen Gunstlagen verfügen, die eine vermehrte Auspflanzung dieser Sorte ermöglichen.
Angesichts des Klimawandels, ist die Widerstandfähigkeit (Resilienz) einer Kulturform von besonderer Bedeutung, also deren Potential sich an geänderte Umweltbedingungen anpassen zu können. Diesbezüglich hat der Streuobstbau mit seiner großen Vielfalt und seinen robusten Baumformen sehr günstige Eigenschaften. Weitere klimarelevante Vorteile des Streuobstbaus sind der niedrige CO2-Fußabdruck auf Grund des geringen Energie- und Betriebsmitteleinsatzes sowie der Regionalität der Produktion. Großkronige, langlebige Obstbäume sind auch als CO2-Speicher von Bedeutung. Der geringe Wasserverbrauch im Streuobstbau ist ebenso ein Vorteil angesichts der sich verändernden Verfügbarkeit von Wasserressourcen. Der Streuobstbau ist somit eine der Tradition verbundene, nachhaltige und damit zeitgemäße und auch zukunftsfähige Form des Obstbaus. Die Bemühungen für die Erhaltung und in Wertsetzung dieser besonderen Kulturform, sind gerechtfertigt und notwendig.
Pomologische Beschreibung „Weißer Rosmarin“
(Dr. Siegfried Bernkopf)
Frucht
Fruchtmuster: ca. 25-jähriger Hochstamm, Gemeinde Ansfelden
Größe: mittelgroß, 55-65 mm hoch, 55-61 mm breit, 74-103 g schwer; Fruchtform: lang stumpfkegelförmig, stielbauchig, gering ungleichhälftig; Querschnitt rundlich; Relief glatt;
Schale: glatt, matt glänzend, mitteldick, zäh; Grundfarbe hellgrünlichgelb bis vollreif hellgelblich; Deckfarbe hell bräunlichrot bis schwach rosa, verwaschen, Deckungsgrad 10-30%; Lentizellen zahlreich, klein, cremefarben, in der Deckfarbe typisch breit hellgelb umhoft;
Stielbucht: tief, eng, oft durch seitliche Wulst eingeengt; Rand glatt bis wulstig;
Stiel: mittellang (17-24mm), dünn, graubraun, holzig, durch Wulst oft zur Seite gedrückt;
Kelchbucht: flach, eng, faltig; teils kleinfleckig braun berostet; Rand gering grobrippig; Kelch: mittelgroß, geschlossen; Blättchen lang, lanzettlich, aufrecht, an der Basis hellgrün und vereint; Spitzen grau, lang zurückgebogen; Kelchhöhle: groß, kegelförmig, teils schwach trichterförmig mit dünner Röhre;
Fruchtfleisch: cremefarben, mittelfest, mittelfeinzellig, saftig, angenehm säuerlichsüß, gering bis mittelstark gewürzt; Zuckergehalt: 10,7-11,5°KMW, 52-56°Oechsle, 12,2-13,2°Brix;
Kerngehäuse: mittelgroß, mittelständig; Achse gering hohl; Kammern schmal, mittelgroß, partiell schlitzartig geöffnet; Wände bogenförmig, glatt bis gering gerissen; Kerne zahlreich, klein, länglich, lang zugespitzt, gut ausgebildet; Gefäßbündel: annähernd herzförmig, teils kreisrund.
Baum: Wuchs stark, Krone auf Sämling flachkugelig bis kugelig
Reife: Ernte Mitte bis Ende Oktober, Genussreife Mitte November bis Mitte März
Verwendung: Tafelapfel, Verarbeitung, Küche
Literatur
Engelbrecht, T.: Deutschlands Apfelsorten, S.245, Braunschweig 1889
Lucas, E., Oberdieck, J.G.C.: Illustriertes Handbuch der Obstkunde, S. 65-66, Stuttgart 1875