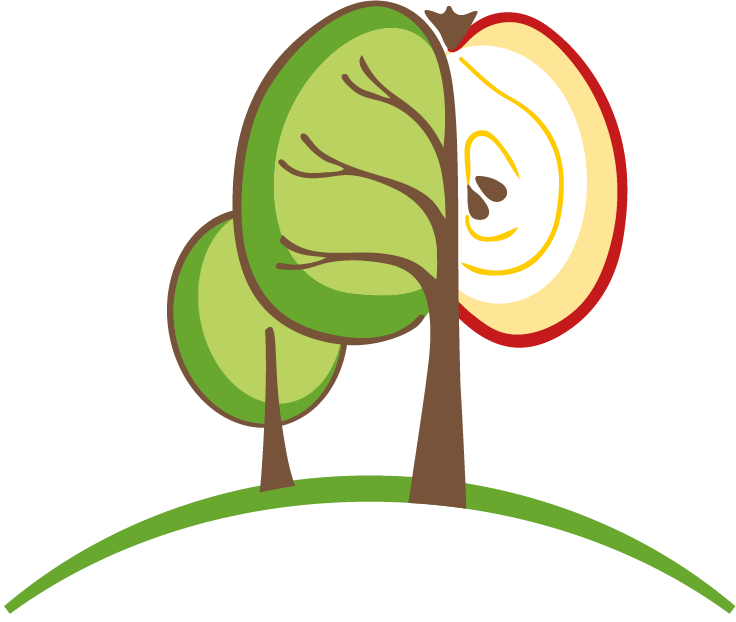Allgemeine Beschreibung
Herkunft und Entstehung der Pfirsichsorte „Eiserner Kanzler“ liegen im Dunkeln. Sie tauchte erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Norddeutschland auf und wurde 1896 als Neuheit bezeichnet. Wann genau sie nach Österreich kam konnte noch nicht eruiert werden. Tatsache ist, dass sie seit etwa 1960 vereinzelt in österreichischen Baumschulen angeboten wird. Sie gilt zusammen mit „Kernechter vom Vorgebirge“, „Roter Ellerstädter“ und „Proskauer Pfirsich“ als sogenannte „Kerngehersorte“.
Viele Gartenbesitzer:innen setzen auf die generative Vermehrung solch „kernechter“ Sorten, in dem sie die Fruchtsteine aussäen und die Sämlinge großziehen. Man geht davon aus, dass diese Sorten weitgehend selbstfruchtbar sind und die Früchte der Sämlinge in ihren wesentlichen Eigenschaften jenen des Mutterbaumes gleichen. Den Pfirsich „Eiserner Kanzler“ findet man in Österreich meist als Wandspalier.
Baumschulbäume weisen je nach verwendeter Unterlage (St. Julien, Hauszwetschke, Wangenheimer, Pfirsichsämling, etc.) mittelstarken Wuchs mit eher schwächeren Leitästen auf. Der Baum gilt als robust (z.B. winterhartes Holz) und nur gering anfällig für Krankheiten (z.B. Kräuselkrankheit). Die hell gelblichweißen und sonnseitig roten Früchte reifen Mitte bis Ende August. Sie sind je nach Standortbedingungen, Baumalter und Behang, mittelgroß bis groß, mittelstark duftend, weiß-fleischig, sehr saftig und mit ausgeprägtem aromatischem Pfirsichgeschmack. Ein besonderes Kennzeichen ist die wollartige Behaarung der Fruchthaut.
In Anbetracht der ohnedies geringen bzw. zunehmend gefährdeten Vielfalt bei den heimischen Pfirsichsorten und der vorteilhaften Eigenschaften hat sich die ARGE Streuobst entschlossen, die Sorte „Eiserner Kanzler“ als Streuobstsorte des Jahres 2023 bekannt zu machen und für ihre Erhaltung zu sorgen.
Pomologische Beschreibung „Eiserner Kanzler“
Synonyme: „Chancelier de Fer”
Herkunft, Verbreitung: Herkunft unbekannt; in Österreich früher häufiger, jetzt aber eher selten anzutreffen
Frucht
Fruchtmuster: von ca. 19-jährigem Viertelstamm Wandspalier, Gemeinde Helfenberg, Mühlviertel, OÖ)
Größe: mittelgroß; 52,0 bis 55,4 mm hoch; 51,1 bis 57,3 mm breit; 53,4 bis 57,8 mm dick; 74,3 bis 102,0 g schwer
Form: Seitenansicht: rund; Vorderansicht: breit oval, teils gering ungleichhälftig; Naht auffällig, mäßig bis seltener mittelstark eingefurcht; Stempelpunkt sehr klein, grau, meist auf schmaler Wulst in mitteltiefem Grübchen aufsitzend
Fruchthaut: stark wollig, dick, zäh, schlecht abziehbar, mittelstark duftend; Grundfarbe hell gelblichweiß bis vollreif hellgelblich; Deckfarbe rot bis braunrot verwaschen, sonnseitig teils deckend, Deckungsgrad 30 bis 70%
Stielbucht: tief, eng; nahtseitig gering eingesenkt
Fruchtfleisch: hell gelblichweiß, weich, sehr saftig; mild säuerlich-süß, gering bis mittelstark sortentypisch gewürzt; mittelgut steinlösend; Zuckergehalt: 9,9 bis 11,3°KMW; 48 bis 55°Oechsle; 11,3 bis 12,9°Brix
Fruchtstein: mittelgroß; Länge: 31,5 bis 35,0 (ø 33,5) mm; Breite: 17,4 bis 19,8 (ø 18,5) mm; Dicke: 23,9 bis 26,8 (ø 25,6) mm; Seitenansicht: breit oval; stempelseitig mit mittelstark ausgezogener Spitze; Oberfläche mittelstark gelocht bis gefurcht; Vorderansicht: mittelbauchig; Bauchwulst mittelbreit bis schmal, mehrfach gefurcht, mittelstark hervortretend; Rückenansicht: Ränder der Rückenfurche stark gesägt
Erntereife: mittelspät, am Standort Helfenberg Mitte bis Ende August
Verwendung: Tafelfrucht, Küche, Schnaps
Baum
Blüte: mittelspät
Wuchs: mittelstark
Anfälligkeiten: widerstandsfähig (Frost, Krankheiten)
Literatur
Anonym: Gartenflora – Zeitschrift für Garten- und Blumenkunde, Bd 45, S. 23, Berlin 1896
Schaal, Gustav: Stein-, Beeren- und Schalenobst, S. 8, Stuttgart 1930
Text und Fotos: Dr. Siegfried Bernkopf