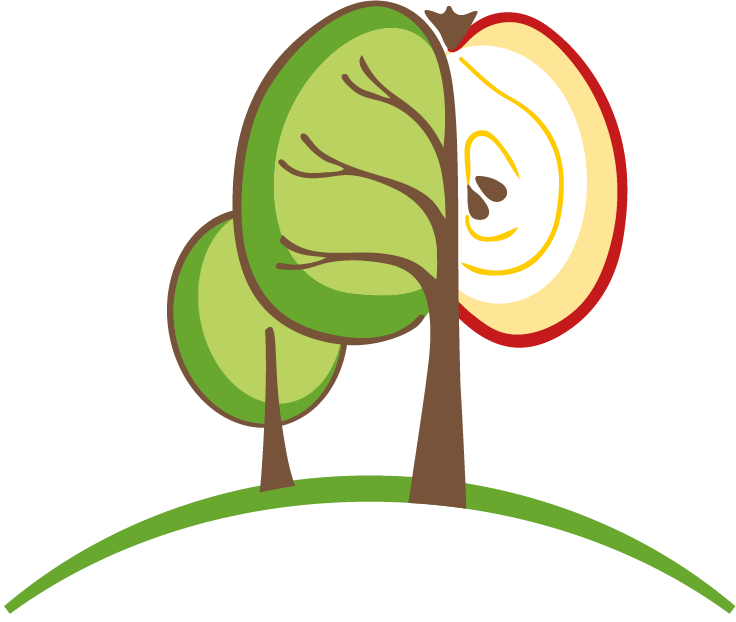Allgemeine Beschreibung
Alten Bäuerinnen und Bauern des Lavanttales, ist die Achatzlbirne zumindest dem Namen nach, oder unter dessen lokalen Varianten, z.B. „Ahatzibirne“, noch ein Begriff. Auch in der alten pomologischen Literatur wurde die Sorte immer wieder erwähnt. So zum Beispiel taucht sie als „Achatzelbirne“ im Katalog der Reichsobstausstellung 1888 in Wien auf. Sie wird als spät reifende, reichlich und früh tragende Mostbirne ersten Ranges bezeichnet. Ebenso erwähnt wird sie um 1900 in der „Monographie des Lavanttales“ von C.F. Keller. Der Lavanttaler Obstbauverein beteiligte sich 1912 an der Reichs-Mostbirnenausstellung in Linz, eine „Achatzlbirne“ war mit dabei.
Verwunderlich ist, dass diese attraktive und wertvolle Mostbirnensorte, in der Zeit nach 1945 bereits als verschollen galt. Grund dafür könnte die Schwachwüchsigkeit und kürzere Lebensdauer der Bäume sein. Erst im Herbst 1996 wurden einige wenige Bäume bei Sortenerhebungen im Lavanttal wieder aufgefunden und anschließend im Obst- und Weinbauzentrum der Landwirtschaftskammer Kärnten weiterveredelt und so erhalten.
Der Name „Achatzl“ leitet sich weder vom Eichkätzchen noch von einem herzhaften Nieser ab. Er bezieht sich auf Matthias Achazel / Matija Ahacel od. Achatzl (1779-1845), einem Kärntner Universalgelehrten. Er war Lehrer für Mathematik, Landwirtschaft und Naturgeschichte am Klagenfurter Lyzeum, als Meteorologe Mitbegründer der Klimaaufzeichnungen in Kärnten und „Kanzler“ (Obmann) der Kärntner Landwirtschaftsgesellschaft (einer Vorläuferin der Landwirtschaftskammer). Er besaß in Viktring einen kleinen botanischen Garten mit einer Obstsortensammlung, der auch für Schulungen genutzt wurde. Mit der Herausgabe des slowenischen Werkes „Kärntnerische und steierische Lieder“, lieferte er auch einen bedeutenden Beitrag zur Kulturgeschichte und Sprachforschung.
(Text: S. Bernkopf, K. Varadi-Dianat & C. Holler, Fotos: S. Bernkopf)
Pomologische Beschreibung „Achatzlbirne“
(Dr. Siegfried Bernkopf)
Synonyme: „Ahatzibirne“, „Achatzelbirne“; Herkunft, Verbreitung: Herkunft ungesichert; wahrscheinlich Zufallssämling aus dem Lavanttal, vermutlich vor 1850; in Österreich sehr selten.
Frucht
Fruchtmuster: ca. 20-jähriger Hochstamm auf OHF333, Gemeinde Weilbach
Größe: klein; 51-61 mm hoch, 59-72 mm breit, 92-144 g schwer; Form: stumpfkreiselförmig, kelchbauchig; gleichhälftig; Querschnitt rundlich bis schwach eckig; Relief glatt bis gering flach kantig, teils gering kelchrippig;
Schale: glatt bis etwas beulig, matt glänzend, mitteldick, mittelzäh; Grundfarbe grün bis gelblich grün; Deckfarbe rot bis braunrot, verwaschen bis deckend, Deckungsgrad 20-50%; Lentizellen zahlreich, klein, graubraun, meist hellgrün bis rötlich umhoft, wenig auffällig;
Stielbucht: flach, eng, teils durch Wulst eingeengt, flächig grau bis graubraun berostet; Rand wulstig;
Stiel: mittellang, 20-26 mm, mitteldick, holzig bis gering fleischig, grünlich grau bis graubraun;
Stielsitz: in Stielbucht eingesteckt, teils von Wulst etwas zur Seite gedrückt;
Kelchbucht: teils fehlend, sehr flach, mittelbreit; Rand glatt bis schwach grobrippig;
Kelch: groß, offen; Blättchen groß, aufliegend, hellgrau, an der Basis vereint; Kelchhöhle: klein, schüsselförmig;
Kerngehäuse: groß, kelchständig; Achse geschlossen; Kammern groß, geschlossen; viele Kerne, mittelgroß, länglich oval, teils lang zugespitzt, schwarz, gut ausgebildet; Steinkranz im Fruchtlängsschnitt kurz spindelförmig, mittelgrob bis grob granuliert;
Fleisch: hell gelblichweiß bis cremefarben, mittelfest, bald weich und teigig, grob- bis mittelfeinzellig, sehr saftig; herb säuerlich-süß, ohne Würze; Zuckergehalt: 14,8-15,6° KMW; 72-76° Oechsle; 16,9-17,9° Brix.
Erntereife: Anfang Oktober; Verwendung: Saft, Most, Schnaps.
Baum: Wuchs schwach; Krone auf Sämling pyramidal, teils schwach hoch kugelig
Sonstige Eigenschaften: relativ robust gegenüber Krankheiten