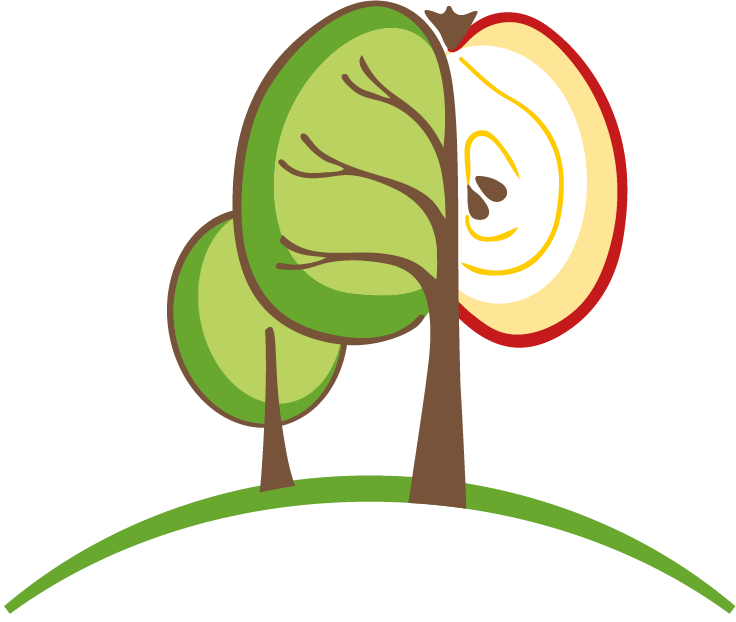Streuobstwiesen planen
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Streuobstbau
Vor der Pflanzung von jungen Hochstämmen sollte man sich einige grundlegende Fragen stellen:
- Ist der Standort geeignet?
- Wieviel Platz steht zur Verfügung?
- Wofür möchte ich das Obst verwenden?
- Auf welche Weise möchte ich die Wiese unter den Obstbäumen nutzen?
Allgemein gültige Voraussetzungen, wie Standorteignung, Boden und Mikroklima und die Größe sowie generell Lage der bepflanzbaren Fläche sollten zuerst geklärt werden.
Sind diese positiv beantwortet, kann man sich an die konkrete Planung machen, in der die Obstarten und Sortenwahl im Mittelpunkt stehen. Bei Nachpflanzungen in bestehenden Streuobstwiesen oder Hausgärten sind diese Fragen weitgehend beantwortet, hier stellen sich meist eher Fragen, ob die vorhandenen Bäume für die zukünftige Nutzung weiterhin geeignet sind, bzw. ob sich eventuelle Revitalisierungsmaßnahmen auszahlen oder es zu einer Neuerstellung der Anlage kommen muss.
Grundsätzlich zu überlegen ist auch die zukünftige Nutzung des erzeugten Obstes. Obstgärten zur Selbstversorgung mit Frischobst haben andere Anforderungen als Streuobstwiesen, in denen die Unternutzung meist zur Gewinnung von Winterfutter oder als Weide ebenfalls von Bedeutung ist und bei denen das erzeugte (Press)Obst zu Saft, Obstwein, Most oder Edelbrand verarbeitet wird.
Der geeignete Standort
Vor allem vor der Anlage eines neuen Obstgartens sollte man sich genau mit den Gegebenheiten des Standortes auseinandersetzen. Der geeignete Boden, ausreichende Wasserversorgung, eine Jahresdurchschnittstemperatur von mindestens 6 °C, keine Spätfrostgefahr im Frühjahr und keine zu tiefen Wintertemperaturen (bei Temperaturen unter -18°C wird es für die Obstbäume kritisch) sind die wesentlichsten Kriterien für einen erfolgreichen Streuobstbau.
Über die Eigenschaften des Bodens gibt eine Bodenprobe Auskunft. Gute Obstbauböden sind mittel bis tiefgründig, nicht zu schwer und leicht sauer. Vom Bodentyp eignen sich Braunerden, der Lehmanteil sollte vor allem bei Kirsche und Birnen nicht zu hoch sein, staunasse Bereiche sind generell, kalkhaltige Böden für Quittenunterlagen ungeeignet.
Checkliste: Eigenschaften guter Obstbauböden
- tiefgründig: der A-Horizont sollte mindestens 20 cm; der B-Horizont mindestens 40 cm mächtig sein
- mittelschwer: Lehm-Ton-Sand in einem ausgeglichenen Verhältnis
- leicht sauer: idealer pH-Wert von 5,5 bis 7
- gut durchlüftet: mindestens 50 % Porenanteil im Boden
- gute Wasserführung: nutzbare Feldkapazität von 150 bis 200 mm/m Bodentiefe
- ausreichender Humusanteil: mindestens 3 %
Wasserversorgung
Die Wasserversorgung ist unter den sich verändernden Klimabedingungen zu einem wichtigen Thema geworden. Mindestens 600 Millimeter Niederschlag, gut verteilt über das Jahr, sind eine grundlegende Voraussetzung. In Trockenperioden wird es dennoch notwendig sein, Jungbäume zu bewässern. Durch die richtige Auswahl der Obstarten kann man in trockeneren Gebieten das Risiko von Baumverlusten geringer halten. Kirsche, Walnuss, Weichsel und Marille sind gegenüber wenig Niederschlag toleranter als Zwetschke und Apfel.
Temperatur
Eine Jahresdurchschnittstemperatur von mehr als 6 °C wird in Österreich beinahe überall erreicht, wo es auch aufgrund der Seehöhe Sinn macht, Hochstammobstbäume anzubauen – das ist in Österreich etwa eine Seehöhe bis zu 1.100 m, bei optimalem Kleinklima auch höher. Aus obstbaulicher Sicht ist es in Grenzlagen wichtig, die Dauer der Vegetationsperiode herauszufinden.
Durch den Anstieg der globalen Temperaturen hat sich diese verlängert. Es ist nun möglich, auch in höheren Lagen über 1.000 m Seehöhe Obstbäume zu pflanzen. Dabei ist es wichtig, Sorten einzusetzen, deren Fruchtreife relativ rasch nach der Blüte eintritt, also vor allem Sommer und Herbstsorten.
Stark spätfrostgefährdete Lagen und Bereiche, in denen sich Kaltluftseen bilden, eignen sich grundsätzlich nicht für Streuobstbau.
Obstarten- und Sortenspezifische Ansprüche
Den Standortanspruch der gewünschten Obstart und der geeigneten Sorte zu kennen, erspart viel Arbeit im Nachhinein. Das gilt auch und vor allem beim Vermeiden von Krankheiten. So sind zum Beispiel „schorfempfindliche Apfelorten“ für Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit wenig geeignet. Nicht standortangepasste Bäume können die gewünschte Leistung nicht erbringen und werden auf Dauer nicht bestehen können. Ist man sich nicht sicher, ob eine Sorte geeignet ist, hilft oft ein Rundgang durch die benachbarten Gärten. Sind die angepeilten Sorten dort zu finden und gesund, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich auch im eigenen Garten bewähren werden.
Ein Streuobstbaum braucht Platz
Auch wenn der junge Baum am Anfang ziemlich unscheinbar aussieht, so sollte einem bewusst sein, dass die Pflanze im Laufe der Jahrzehnte groß wird und im Idealfall zu einem imposanten Landschaftselement heranwächst. Aus diesem Grund muss im Vorhinein auf ein ausreichendes Platzangebot für später geachtet werden.
Je nach Obstart benötigen Hochstämme einen Standraum von 80 bis 100 m², Halbstämme zwischen 60 und 80 m². Walnussbäume und Mostbirnen sind besonders starkwüchsig. Sie haben etwa 120 m² Platzbedarf. Bei der Anlagenplanung sollte außerdem an genügend Abstand von der Grundgrenze, etwa 1,5mal die Endhöhe des Baumes, geachtet werden, um eine eventuelle Beeinträchtigung, wie Schattenwurf, Fallobst, Blätter und Äste zu vermeiden. Außerdem sind geeignete Zufahrtswege und Rangiermöglichkeiten für größere Fahrzeuge innerhalb des Obstgartens einzuplanen. Wird all dies berücksichtigt, werden selten mehr als 60 bis 80 Bäume pro Hektar Platz finden.
Geplante Unternutzung als Fläche zur Tierhaltung oder als Freizeitfläche
Bei einer Neuanlage einer Streuobstwiese ist die zukünftige Nutzung der Fläche unter den Obstbäumen miteinzuplanen. Nach ihr richtet sich nicht nur die Anzahl der Bäume und ihre Verteilung, sondern auch Maßnahmen zum Baumschutz und eventuelle Einzäunungen rund um die Obstgartenfläche. Ist eine landwirtschaftliche Nutzung zum Beispiel als Mähweide (ein oder mehrmähdig) oder als Auslauf für Hühner, Gänse, Schafe etc. geplant, sollten die Baumabstände mindestens 10 × 10 m betragen und die Bepflanzung in einem regelmäßigen Raster erfolgen, damit eine maschinelle Bewirtschaftung erleichtert wird. Beim Tierbestand sollte man bedenken, dass durch die Beschattung des Bodens, die Weidefläche um etwa ein Drittel weniger Ertrag an Grünmasse abwirft und daher entsprechend weniger Tiere gehalten werden können.
Wird die Fläche eher als Erholungsraum genutzt, sollten verschiedene Biodiversitätsmaßnahmen in Betracht gezogen werden, damit sich Kleintiere und verschiedene Wiesenpflanzen auch in dieser Umgebung wohlfühlen.
Auswahlkriterien Obstart und Obstsorte im hochstämmigen Landschaftsobstbau
- ausreichend Standraum
- zukünftige Nutzung des Obstes: Frischverzehr, Saft, Most, Brand, Essig, Trockenobst, etc.
- maschinelle Bearbeitbarkeit
- geplante Unternutzung
- Alternanzneigung
- Anfälligkeit gegen Krankheitserreger und abiotische Schäden (z.B. Frost)
- Biodiversitätsaspekte
Auswahlkriterien Obstarten und -sorten im Hausobstgarten und bäuerlichen Selbstversorgerobstbau
- Ziel ist die ganzjährige Versorgung mit Frischobst, evtl. auch Saft
- Arten und Sorten verschiedener Reifezeit
- Lagerung und Verarbeitung je nach Möglichkeiten und Bereitschaft
- ertragssichere, widerstandsfähige und standortangepasste Sorten
- „persönliche Lieblingssorten“