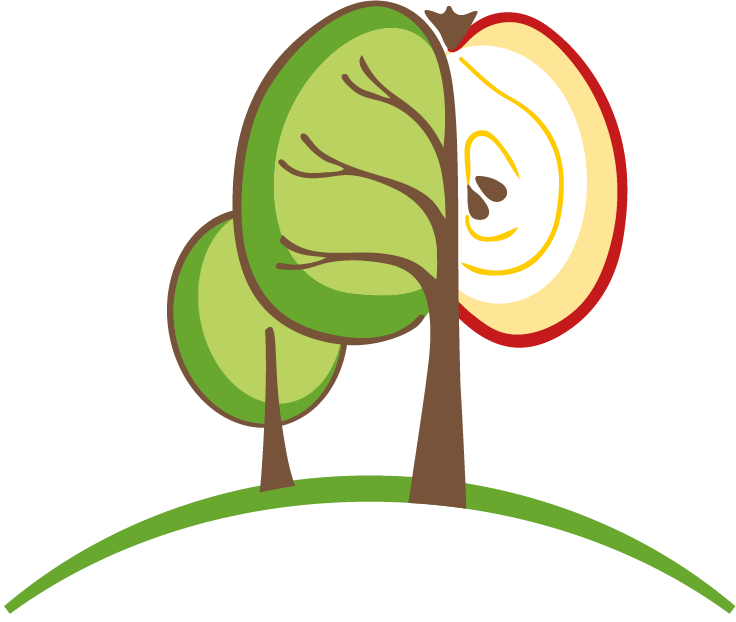Autor: Wolfgang Weingerl
Streuobstwiesen sind mit ihrer Zweitnutzung als Grünlandfläche wertvolle Flächen für Landwirtschaft und Ökologie. Um die Bewirtschaftung zu erleichtern, ist das Ausmähen der Obstbäume vorab zu erledigen. Der Griff zur Motorsense ist dazu üblich, dabei ist eine gut zugerichtete klassische Sense durchaus ersterer ebenbürtig. Ein paar weitere Argumente sprechen auch für sie. Die Gefahr des Verletzens vor allem von Jungbäumen ist mit der Motorsense relativ groß und bringt gerade im unteren Stammbereich oft schwere Folgeschäden. Spätes Mähen zum Aussamenlassen zahlreicher Blütenpflanzen , die Bekämpfung von krautigen Neophyten und letztendlich die Tätigkeit als Beitrag zur Fitness sprechen für dieses uralte und wieder aktuelles Werkzeug.
Für die ältere Generation ist die Sense und ihre Behandlung selbstverständlich, durch den verstärkten Einsatz von motorbetriebenen Geräten und oft mangelnde Zeit laufen wir Gefahr, das Wissen um die Pflege dieses Werkzeug zu verlieren.
Wie bei allem Werkzeug ist die gute Schneide die halbe Arbeit, deshalb gehört sie gut hergerichtet. Leider ist die Versuchung groß, mit Winkelschleifer und dergleichen eine scheinbare Schärfe zu erreichen. Spätestens, wenn diese schnell vorbei ist, wird das Sensenmähen zur Plagerei und die Motorsense wird wieder zur willkommenen Konkurrenz. Dabei ist das Mähen mit einer gut hergerichteten Sense nicht viel anstrengender als mit der Motorsense.

Vorerst ist die Auswahl der passenden Sense wichtig, da sie der Körpergröße des Nutzers angepasst sein soll. Das Sensenblatt ist je nach Verwendung (von kurzen Staudensensen bis langen Grünlandsensen) auszuwählen und soll aus gutem Stahl geschmiedet sein. Ein gängiges Maß als Wiesensense ist 75 cm Blattlänge. Der Worb (Sensenbaum, Knittel) kann aus Stahl oder Holz bestehen und ist als Handelsprodukt zumeist zu kurz für die Nutzer. Wenn man die Sense mit dem vorderen Ende (an dem das Blatt befestigt wird) auf den Boden stellt, soll sich der hintere Griff auf der Höhe zwischen Mund und Nase befinden. Der vordere Griff lässt sich zumeist am Worb verschieben und soll sich auf der gleichen Höhe wie die Oberseite des waagrecht abgewinkelten Oberschenkels befinden. Der hintere Griff soll so positioniert sein, dass der Ellbogen am vorderen Griff angelegt wird und die Fingerspitzen der flach ausgestreckten Hand ca. 10 cm Entfernung zum hinteren Griff frei haben. Für den Holzworb ist Eschenholz gut geeignet, das recht dünn ausgearbeitet werden kann und damit auch recht leicht ist. Der Worb sollte weniger als ein Kilo Gewicht haben, jedes Gramm mehr benötigt mehr Kraft. Das Ende des Worbs sollte flach auslaufen, damit das Sensenblatt nicht zu steil über die Wiese gleitet, aber auch nicht zu flach, um den Kontakt der Schneide mit Steinen und Erde zu vermeiden. Das kann durch die Form des Worbs oder Einlegen eines Keils erreicht werden. Bei vorrangiger Verwendung zur Böschungspflege oder bei steilen Flächen kann die Länge des Worbs kürzer gewählt werden.
Das Dangeln
Die Zurichtung der Schneide ist die wichtigste Arbeit, da sie eine gewaltige Arbeitserleichterung bedeutet. Nicht das Wetzen, sondern das Dangln macht die Schneide, womit das dünne Austreiben des Sensenblattstahls auf Rasierklingenstärke gemeint ist. Laufend soll vom Blatt Material in Richtung Schneide gebracht werden und die feine Schneide während des Gebrauchs mit dem Wetzstein nur nachgeschärft werden. Die gedangelte Schneide ist 5 bis 6 mm breit und soll so dünn sein, dass sie beim Andrücken mit dem Daumennagel nachgibt. Je nach Mähgut ist der Dangel kürzer (bei holzigeren Pflanzen) oder länger bei reinen Wiesenflächen auszuformen. Daraus ergibt sich die Empfehlung, mehrere Sensen griffbereit zu haben.
Zum Dangeln gibt es mehrere Methoden. Die klassische erfordert einen kleinen Amboss und einen Dengelhammer.

Der Amboss wird am Dangelstock eingeschlagen, die Unterlage muss auf jeden Fall schwer genug sein, um die Schläge des Hammers aufzunehmen – zu „ziehen“. Beginnend mit dem Bart, wird das Blatt mit der bauchigen Seite nach oben dünn ausgetrieben, und dabei laufend weiter gezogen. Der Vorgang beginnt im dickeren Bereich des Blattes (ca. 5 mm vom Schneidenrand und muss möglicherweise einige Male wiederholt werden, wobei die Gleichmäßigkeit des Dangelns an allen Stellen der Schneide wichtig ist und immer mehr zur Schneide hin gearbeitet wird. Durch das Dangeln kommt es auch zu einer Kaltverfestigung der Schneide.

Um die Treffsicherheit zu erhöhen, gibt es einen Dangelapparat, dessen Unterteil ebenfalls in einen schweren Holzteil eingeschlagen wird (im oberen Bild links). Eine Hülse wird über den leicht eingeölten Zapfen gesteckt, die Schneide des Sensenblatts in den Spalt zwischen Hülse und Unterteil geklemmt und mit Hammerschlägen auf die Hülse das Blatt ausgetrieben. Die unterschiedliche Ausführung der zwei Hülsen ermöglicht ein grobes und ein finales, feines Austreiben.
Ohne Schläge kommen zwei Vorrichtungen aus, die das Material des Sensenblattes nach vorne quetschen. Der als Union-Dangelapparat bezeichnete Dangelstock quetscht mit zwei von einem Handhebel bewegten Backen das Blatt, das kontinuierlich weitergezogen werden muss.

Dies muss gefühlvoll geschehen, um ein Einreißen der immer härter werdenden Schneide zu vermeiden. Ein anderer Apparat drückt Stahlkugeln, die in einem umlaufenden Kranz geführt werden, gegen das Blatt und „rollt“ gleichsam die Schneide aus.

Beide Apparate ermöglichen lärmarmes ermüdungsarmes Arbeiten, die beste endgültige Schneide ist aber zumindest zum Schluss durch den klassischen Sensendengelhammer meines Erachtens am besten zu erreichen.
Die Sense einstellen
Ist das Sensenblatt ausreichend gedangelt, wird es mit der Warze am Worb eingesetzt und mit dem Ring daran fixiert. Um den richtigen „Hub“ der Sense einzustellen, geht man folgendermaßen vor: Die Sense wird mit dem hinteren Ende vor eine Wand oder einem Baum am Boden aufgestellt und an der Wand eine Markierung gemacht, wo die Schneide am Bart des Blattes die Wand berührt. Sodann kippt man die Sense so weit zur Seite, dass sich die Spitze des Blattes neben der Markierung befindet. Die Spitze sollte sich in etwa 3 bis 4 cm unterhalb der Markierung befinden und gegebenenfalls nachgestellt werden.

Bei einem Holzworb ist das seitliche Anleimen eines Keils am Worb zur Fixierung der Hamme gegen ein Verschieben im Sensenring („Schloss“) möglich und generell festes Anziehen der Ringschrauben empfehlenswert, da recht große Kräfte auf diesen Teil der Sense wirken.

Das Wetzen
Natur- und Kunstwetzsteine stehen zur Verfügung, vor allem die Naturmaterialien sollen nur nass verwendet werden, am besten durch die Mitnahme eine sogenannten Kumpfs, der ursprünglich aus Holz gedrechselt oder aus einem Rinderhorn angefertigt war, am Gürtel eingehängt werden kann und den Wetzstein im Wasserbad aufbewahrt. Das Sensenblatt wird von anhaftendem Gras gesäubert und mit der Schmalseite des Steins in Richtung des Barts beiderseits abwechselnd gewetzt. Übermäßiges Wetzen verbraucht natürlich viel Stahl der Sense und macht baldiges Dangln wiederum notwendig. Der Wetzstein muss sauber gehalten werden, damit anhaftende Stahlspäne nicht durch die Bildung von Eisenoxid die Oberfläche des Wetzsteins verklebt.
Mit einer scharfen und gut eingestellten Sense kann das Mähen leicht von der Hand gehen und in Bereichen, in denen Mähmaschinen nichts mehr ausrichten können, sehr flexibel gemäht werden. Einige Obst- und Gartenbauvereine kümmern sich bereits um diese Wissensvermittlung, weiters ist der Sensenverein Österreich (www.sensenverein.at) sehr aktiv und vermittelt sehr gutes Werkzeug dazu. Als Anregung soll die Aufforderung verstanden werden, in der eigenen Umgebung nach Wissenden im Umgang mit der Sense zu suchen, dieses Wissen gemeinschaftlich zu erwerben und weiterzugeben!